 Was wir uns über uns selbst erzählen, und was das für einen Einfluss auf unser Leben hat
Was wir uns über uns selbst erzählen, und was das für einen Einfluss auf unser Leben hat
Vortrag von Ulrich Küstner
in der Online-Veranstaltungsreihe „Tara Rokpa kennenlernen“, 4. Feb. 2021
Einleitung
Ausgangspunkt und Inspiration für diesen Vortrag ist die Phase „Zurück zu den Anfängen“ bei Tara Rokpa.
Bei Tara Rokpa gibt es Elemente, die sich als Basismethoden durch den ganzen Prozess hindurchziehen, Gruppe, freie Kunstarbeit, verschiedene Übungen und andere Methoden, die nur während bestimmter Phasen geübt werden. Dabei kommen dann zusätzliche Themen dazu.
Der Übungsweg beginnt mit Heilsame Entspannung, die uns zunächst einmal zur Ruhe kommen und Vertrautheit mit den Übungen gewinnen lässt. Das machen wir auch in dieser Veranstaltungsreihe jede 2. Woche, abwechselnd mit den Vorträgen.
Danach kommt die Phase, die der Hintergrund für den heutigen Vortrag ist: Zurück zu den Anfängen. Das ist eine intensive, längerdauernde Arbeit. Dabei geht es um eine Beschäftigung mit unserer Lebensgeschichte, deren Einfluss auf unser Leben und unser Selbstbild. Wir machen darin eine ziemlich gründliche und möglichst realistische Bestandsaufnahme für das, was dann der Ausgangspunkt für unser weiteres Leben ist.
Wobei bereits die Bestandsaufnahme zu Veränderungen führen kann.
Es ist eine Chance für einen frischen Blick auf uns selbst, ein In-Frage-stellen unserer Muster und Narrative, an die wir uns seit langem gewöhnt haben. Man könnte sagen: Zurück zum Anfängergeist. Wie mit den Augen des Anfängers frisch schauen.
Ganz praktisch erinnern wir uns dabei chronologisch durch unser Leben hindurch, und zwar drei Mal, einmal rückwärts von jetzt bis zur frühen Kindheit, dann vorwärts mit der Zeitachse bis jetzt, und dann noch einmal rückwärts bis zur frühen Kindheit. In aller Regel machen wir dieses Durcherinnern schreibend. Dies wird unterstützt durch bestimmte Techniken der Verarbeitung und nonverbale Methoden wie freies Malen. Der ganze Prozess dauert etwa 2 Jahre, manchmal auch etwas mehr.
Ich möchte heute nicht mehr über die praktische Ausführung sagen – das wird dann im Prozess ausführlich über mehrere Wochenendkurse vermittelt und geübt.
Es gibt unendlich viele Arten, diesen Freiraum zu nutzen. Keine davon ist falsch, wenn sie den TeilnehmerInnen nutzt.
Aber diese Arbeit hat so viele Aspekte, dass es vielleicht interessant ist, einiges gesondert zu erwähnen, das wir sonst übersehen könnten, wenn wir mit einer zu engen Sicht herangehen. Das ist mein Ausgangspunkt für den heutigen Vortrag.
Nicht nur Autobiographie, nicht nur Psychotherapie
Viele nennen „Zurück zu den Anfängen“ eine Biographie-Arbeit (eigentlich: Autobiographie-Arbeit). Die eingeengte Sicht ist dabei, dass eine Autobiographie immer auch an ein Publikum denkt. Auch wenn man nur sich selbst als Leserin sieht, oder eine fantasierte Instanz, für die man schreibt: „Liebes Tagebuch…“. Dabei versucht man bewußt oder unbewusst eine bestimmte Form oder Schlüssigkeit zu wahren. Darum geht es bei der Erkundung in „Zurück zu den Anfängen“ nicht.
Ein anderes Beispiel für ein zu enges Verständnis dieser Arbeit: Wenn wir das Schreiben nur als eine Psychotherapie sehen, bei der wir unsere Vergangenheit aufarbeiten oder verarbeiten sollen, oder Traumata überwinden. Dabei geht es bei „Zurück zu den Anfängen“ eben nicht um spezielle schwierige Erfahrungen und deren Bewältigung, sondern um Einsicht in grundsätzliche Mechanismen des Werdens als Mensch, die Bildung unserer Identität, unserer Gewohnheiten, und unserer Art zu leben. Deshalb braucht man auch für diese Arbeit keine psychischen Störungen oder Traumata mitbringen. Was uns hier beschäftigt, trifft für alle Menschen zu.
Und ein letztes mögliches Mißverständnis, eine eingeengte Sicht wäre: Wenn wir das, wie wir geworden sind, und jetzt sind, als unveränderliche Tatsache der Vergangenheit sehen, und vielleicht sogar dazu benutzen, Veränderung zu vermeiden.
Es geht hier nicht um Objektivität oder Wahrheit, wie es „wirklich“ war, oder „wie ich wirklich bin“ – sondern um das, was mich weiterbringt.
Je mehr wir verstehen, dass das, was wir sind, kontingent ist – abhängig von Ursachen und Bedingungen – desto weniger wichtig wird es uns, es um jeden Preis festzuhalten und zu verteidigen.
Drei Themenfelder
Ich möchte meinen Vortrag in drei Themenbereiche aufteilen.
- Schreiben als Therapie, oder Autobiographisches Schreiben als Therapie, als Selbsthilfe, als Weg zur Kreativität.
- Das Autobiographische Gedächtnis, dem Hintergrund jeder Erinnerungsarbeit. Womit arbeiten wir eigentlich; was können wir erwarten, wenn wir uns versuchen zu erinnern.
- Selbst als Erzählung, oder Selbstbild als Narration; die „Geschichten, nach denen wir leben“ (McAdams). Es geht um die Theorie, dass unser Selbst, unser Selbstgefühl, eine Geschichte ist, die wir uns selbst und anderen erzählen.
Autobiographisches Schreiben als Therapie, Selbsthilfe, und Weg zur Kreativität
Eigentlich passt der Begriff „Autobiographisches Schreiben“ bei Tara Rokpa nicht so recht, denn wir schreiben keine Biographie. Primär geht es um Erinnern und Verstehen, gleich ob wir das mit Schreiben machen oder anders.
Gerade das nichtverbale Arbeiten mit Kunstmaterialien, freies Malen usw. ist ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit. Das wird im heutigen Vortrag zu kurz kommen, weil ich einen bestimmten Schwerpunkt setzen möchte – das heißt aber nicht, dass es weniger wichtig ist.
Autobiographie als kulturelles Phänomen
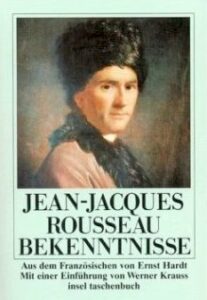 Nach dieser Vorbemerkung nun ein kurzer Blick auf die Geschichte des autobiographischen Schreibens. Die Autobiografie als literarisches Genre kommt in der uns bekannten, klassischen Form erst aus der europäischen Aufklärung. Auch wenn es Vorläufer in der Antike gab.
Nach dieser Vorbemerkung nun ein kurzer Blick auf die Geschichte des autobiographischen Schreibens. Die Autobiografie als literarisches Genre kommt in der uns bekannten, klassischen Form erst aus der europäischen Aufklärung. Auch wenn es Vorläufer in der Antike gab.
Die Autobiographie ist eine Geschichte in der ersten Person, die ein Leben fortlaufend beschreibt, und zwar aus der Sicht von heute aus gesehen. Sie versucht, vollständig und zusammenhängend zu sein. Sie ist immer ein Balanceakt zwischen Wahrheitstreue und kreativer Überzeichnung, zwischen Vergessen, absichtlichem Verschweigen und dem verdrucksten Lob der eigenen Großartigkeit (frei nach Helga Schwalm 2014).
Diese Form der Autobiographie ist kulturspezifisch, sie hat einen historischen Kontext, innerhalb von dem sie Sinn machen soll. Bekannte Vorbilder in unserer literarischen Geschichte sind Rousseau, Goethe, Dickens, Proust usw.
Zwar ist diese Art von Autobiographie als literarisches Genre nicht das, womit wir uns hier beschäftigen, aber diese Vorbilder, diese kulturspezifische Art auf ein Leben zu schauen, haben wir verinnerlicht und es beeinflusst natürlich unser Schreiben, ob wir das wollen oder nicht.
Schreiben als Selbstheilung
Durch die Jahrhunderte haben Menschen festgestellt, dass das Erzählen und das Aufschreiben ihrer Erinnerungen etwas Heilsames hat. Erzählen, oder Beichten, gehört zu den klassischen Heilritualen.
Den Übergang von der Beichte zur einer Literaturform sehen wir exemplarisch in den „Confessiones“, den Bekenntnissen des christlichen Kirchenlehrers Augustinus um 400 n.Chr.
Eine moderne Inkarnation ist z.B. das „Expressive Schreiben“ von James Pennebaker, amerikanischer Psychologie-Professor an der University of Texas in Austin. Sein Ausgangsgedanke war, ganz simpel: „Hemmung ist ein Gesundheitsrisiko“ (Pennebaker 1997). Wenn wir unsere Gefühle und Gedanken behindern oder blockieren oder verhindern, wird das negative Auswirkungen auf unsere seelische und körperliche Gesundheit haben.
Umgekehrt, das freie Ausdrücken unserer Gedanken und Gefühle kann heilsam wirken. Das sehen wir auch im Begriff der „Redekur“, wie die Psychoanalyse Sigmund Freuds genannt wurde.
 Diese Redekur in einen persönlichen Schreibprozess zu verlagern, ist bei aller Schlichtheit eine geniale Idee. Im Gegensatz zur persönlichen Öffnung in der Therapie bleibt beim eigenen Schreiben die Kontrolle vollständig bei uns selber. Die Vertraulichkeit bleibt gewahrt, wir haben die Sicherheit, dass niemand unsere Bekenntnisse in irgendeiner Weise gebrauchen oder missbrauchen kann.
Diese Redekur in einen persönlichen Schreibprozess zu verlagern, ist bei aller Schlichtheit eine geniale Idee. Im Gegensatz zur persönlichen Öffnung in der Therapie bleibt beim eigenen Schreiben die Kontrolle vollständig bei uns selber. Die Vertraulichkeit bleibt gewahrt, wir haben die Sicherheit, dass niemand unsere Bekenntnisse in irgendeiner Weise gebrauchen oder missbrauchen kann.
Gleichzeitig ist das therapeutische Schreiben jedermann zugänglich, und unschlagbar billig: Es braucht nur einen Stift und einen Block. Damit gibt es auch solchen Menschen, die sich nicht in eine Therapie begeben würden, die Möglichkeit zur inneren Verarbeitung von Gedanken und Gefühlen.
 Die Medizinforscherin Gillie Bolton, die über therapeutisches Schreiben an der University of Sheffield forscht, hat sich damit selbst durch eine traumatische Vergangenheit gearbeitet, und sagt von sich selbst: „Einem Therapeuten hätte ich mich damals nicht öffnen können“.
Die Medizinforscherin Gillie Bolton, die über therapeutisches Schreiben an der University of Sheffield forscht, hat sich damit selbst durch eine traumatische Vergangenheit gearbeitet, und sagt von sich selbst: „Einem Therapeuten hätte ich mich damals nicht öffnen können“.
In den letzten Jahrzehnten hat sich das Schreiben als Therapie und vor allem als Selbsthilfe ungeheuer verbreitet. Das erwähnte „Expressive Schreiben“ von James Pennebaker ist dabei eine der verbreitetsten Methoden. Es ist eine sehr simple und kurze Methode: Man soll an 4 Tagen je 15-20 Min. lang frei schreiben. Dabei geht es um ein offenes Eingestehen und Sich-Konfrontieren mit den eigenen tiefsten Gedanken und Gefühlen. (Ausführlicher z.B. in: Pennebaker (2010): „Heilung durch Schreiben“).
Bereits diese kurze und einfache Intervention des Expressiven Schreibens hat offenbar ungeheuer positive Wirkungen, seelisch wie körperlich. Darüber gibt es zahlreiche Studien (siehe z.B. Horn und Mehl 2004); es wird die bestuntersuchte Methode im Selbsthilfebereich genannt.
Nun ist das reine Ausdrücken von Gefühlen noch nicht alles. Die amerikanische Literaturprofessorin Marilyn Chandler (1990) beschreibt drei Phasen der therapeutischen Wirksamkeit des autobiographischen Schreibens:
- Katharsis, oder Reinigung
- Restoration, einen Abschluss finden
- Transformation, etwas Neues daraus machen
Auch die erwähnte englische Forscherin Gillie Bolton sagt, dass das Bearbeiten und Überarbeiten des Erinnerten wichtig ist. Nicht nur das erste kathartische Rausschütten zählt. Damit kann man aber anfangen: Sie schlägt z.B. vor, sechs Minuten einfach zu schreiben, was einem in den Sinn kommt, ohne Überarbeitung, ohne auf Grammatik oder Rechtschreibung zu achten, und ohne dabei innezuhalten. Man nennt das einen „mind dump“ – eine geistige Müllkippe. Danach sollte man aber möglichst konkret werden. Z.B. bei Kindheitserinnerungen: „Stelle dir vor, ein Objekt in der Hand zu halten das dir mal wichtig war. Beschreibe es, und schreib auf, was dann kommt.“
Diese Konkretheit ist typisch für das therapeutische Schreiben, im Vergleich z.B. zum Tagebuchschreiben. Viele Tagebücher bleiben oberflächlich. Sie werden sogar oft benutzt, um tiefere Fragen zu vermeiden und sich in der eigenen Subjektivität im Kreis zu drehen. Das sollte durch entsprechende Techniken verhindert werden.
Auch James Pennebaker (2010) empfiehlt, nicht immer wieder über dasselbe Thema zu schreiben, und er hat zusätzliche Mittel wie Rückblick und Auswertung, oder den Perspektivenwechsel, das Schreiben aus der Sicht einer anderen Person, in seine Methode aufgenommen.
Viele solcher Methoden stimulieren die Erinnerung durch vorgegebene Fragen und Themen. Das macht das „Zurück zu den Anfängen“ bei Tara Rokpa explizit nicht. Wir empfehlen sogar, nicht themenfokussiert zu schreiben. Das Durcharbeiten geschieht bei „Zurück zu den Anfängen“ durch eine empfohlene Struktur von erneutem Lesen, Zusammenfassen und Bewerten, aber ohne irgendwelche inhaltlichen Vorgaben.
Wichtig scheint mir hier die Betonung des Konkreten und Spezifischen. Untersuchungen haben gezeigt, dass depressive Menschen dazu neigen, ihre autobiografischen Erinnerungen in verallgemeinerter Form mitzuteilen, also verschiedene Ereignisse zusammenzuziehen und in generalisierter, unkonkreter Weise darüber zu sprechen (Williams 2007, zit.n. Boritz et al 2008). Es gibt Hinweise darauf, dass es dann therapeutisch hilfreich sein kann, an spezifischen, konkreten, emotional bedeutsamen Erinnerungen zu arbeiten, um diesen Prozess umzukehren (Boritz et al 2008).
Das sind Befunde aus dem Umgang mit autobiographischen Erinnerungen in der Psychotherapie, was nicht unser heutiges Thema ist. Aber es scheint mir von großer Bedeutung für unsere Praxis der Erinnerungsarbeit zu sein.
Schreiben und Kreativität
Nun zu einem anderen Feld des therapeutischen Schreibens. Obwohl es natürlich einen großen Unterschied zwischen den beiden gibt, kann das therapeutische Schreiben auch zum kreativen Schreiben oder allgemein zu Kreativität führen.
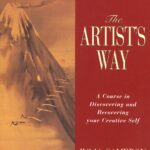 Die bekannteste Protagonistin ist dabei vielleicht Julia Cameron mit ihrem Buch „Der Weg des Künstlers“ (Erstveröffentlichung 1992). Sie hat darin Methoden gelehrt wie: die Morgenseiten, den Künstlertreff usw. Im Kern geht es um das freie, von Blockaden befreite Schreiben, und dadurch die Entdeckung der KünstlerIn in uns.
Die bekannteste Protagonistin ist dabei vielleicht Julia Cameron mit ihrem Buch „Der Weg des Künstlers“ (Erstveröffentlichung 1992). Sie hat darin Methoden gelehrt wie: die Morgenseiten, den Künstlertreff usw. Im Kern geht es um das freie, von Blockaden befreite Schreiben, und dadurch die Entdeckung der KünstlerIn in uns.
Faszinierend ist, wie einfach ihre Methoden sind und wie wirksam sie gerade in dieser Einfachheit sind.
Was sie sonst noch daraus machte, ihre 30 anderen Bücher und verschiedenen Programme, darum geht es hier nicht. Aber die Grundidee ist überzeugend: Der freie Fluss von Gedanken, Gefühlen und Erinnerungen ist heilsam und stimuliert unsere Kreativität. Und das auch noch, wenn wir schon etwas älter sind, schreibt sie 2017 in: „Es ist nie zu spät, neu anzufangen: Der Weg des Künstlers ab 60“ und bezieht dabei explizit den Lebensrückblick ein.
Autobiographisches Gedächtnis
Nun kommen wir zum zweiten Teil: Das autobiographische Gedächtnis als Forschungsgegenstand. (Das folgende Material stammt zu einem guten Teil aus Pohl (2007) und McAdams (2001), siehe auch Wikipedia)
Es ist sind spannende Fragen, wie wir Informationen über uns selbst und unser Leben abspeichern, bewahren und wieder abrufen. Wir wissen darüber immer noch relativ wenig, vieles sind zunächst nur plausible Theorien.
Warum sollen wir uns dann damit beschäftigen?
Weil es wichtig ist dafür, wie wir mit uns selbst umgehen, wenn wir uns auf den Weg einer Erinnerungsarbeit machen! Es ist nützlich, etwas darüber wissen, was über Gedächtnisfunktionen bekannt ist.
Die Forschung beschäftigte sich dabei zunächst mit drei Fragekomplexen:
- Wie wahrheitsgetreu sind unsere Erinnerungen?
- Warum erinnern wir das eine Ereignis und andere vergessen wir?
- die Organisation autobiographischen Wissens allgemein
Wie wahrheitsgetreu sind unsere Erinnerungen?
Die meisten Menschen, mit denen man beginnt über Erinnerungsarbeit zu sprechen, werden zunächst sagen, sie hätten ein schlechtes Gedächtnis.
Wir wissen alle, dass wir viele Erinnerungen haben, wenn die Ereignisse nur kurz zurückliegen. Dann wird es rasch weniger. Man nennt das die Abklingkurve des Gedächtnisses, und man kann sie ziemlich genau mathematisch beschreiben und das bestätigt sich auch in Untersuchungen.
Bei diesem Abklingen der Erinnerung über die Zeit kommen dann zwei Arten des Gedächtnisses zur Anwendung:
Was kurz zurückliegt, reproduzieren wir. Das heißt, wir erinnern die tatsächlichen Details. Es handelt sich um das episodische Gedächtnis.
Was länger zurückliegt, rekonstruieren wir immer mehr. Ältere Erinnerungen sind oft schematisch und bestehen dann zu großen Teilen aus generischen Erinnerungen, bei denen wir mehrere oder wiederholte Ereignisse zu einer Erinnerung zusammenfassen. „Das Gedächtnis reimt sich die Dinge zusammen“ (Pohl 2007). Wir erinnern uns also aus der Ferne oft nur an die groben Konturen unserer Vergangenheit, und haben nur noch relativ wenige Erinnerungen an spezifische Episoden.
Verschiedene Theorien sprechen von „generalisierten Szenen“, oder von „Skripten“. Wenn wir sagen: Wir haben Pizza gegessen, dann enthält dies ganz viele Elemente von dem, was meist zum Pizza essen gehört: ein italienisches Restaurant mit rotkarierten Tischdecken und Rotwein, die Art und Weise, wie wir an einen Tisch gehen und Platz nehmen, Kellner kommen und wieder gehen usw. So etwas erinnern wir nicht mehr im Detail, sondern wir füllen die Erinnerung aus mit dem, wie so etwas üblicherweise ist. (Wenn wir uns später an Pizza essen im Jahr 2020 erinnern, werden wir die Erinnerung eher mit unseren Erfahrungen mit Lieferdiensten ausfüllen).
Positiv formuliert: Unser Gedächtnis hat eine außerordentliche Fähigkeit, ähnliche Ereignisse zusammenzufassen und zu abstrahieren (Pohl 2007). Man könnte sagen, das episodische Erinnern wird zunehmend zum semantischen Gedächtnis: Wir wissen vieles nur noch, als Faktenwissen, ohne es noch innerlich nachzuerleben.
Dies klappt in der Praxis meist erstaunlich gut. Andererseits ist das, was wir erinnern, doch immer wieder erstaunlich falsch. Weil wir konfabulieren.
Erinnern und Vergessen

Die Qualität der Speicherung von Ereignissen wird bedingt von:
- Wiederholung
- Aufmerksamkeit
- emotionaler Beteiligung
Die Wiederholung von Erinnerungen kann einen Inhalt verfestigen, ihn aber auch verfälschen – durch das Hochholen und Elaborieren verändert sich die Erinnerung, meist ohne dass wir dieses bemerken.
Wie auch immer, der Verfall von Gedächtnisspuren ist unausweichlich und resultiert in der erwähnten Vergessenskurve. Das Gedächtnis enthält also immer mehr, als wir momentan abrufen können, aber weniger, als wir insgesamt aufgenommen haben.
Es gibt Forschungsgruppen (Crovitz et al. zit. n. Pohl 2007), die meinen, dies berechnen zu können: Innerhalb des jeweils zurückliegenden Jahres, über 365 Tage, speichern wir 175.000 Episoden ab, erinnern aber nur 123 davon. Eine 50-jährige Person hat zwar 9 Millionen Episoden erlebt und gespeichert, aber nur weniger als 300 davon sind zugänglich.
Das ist eine errechnete Zahl, sie blieb nicht unwidersprochen. Manche haben das am eigenen Leben überprüft; eine 62-jährige Forscherin kam auf ungefähr 6000 erinnerbare Episoden in ihrem Leben zit.n. Pohl 2007), woran sie aber wohl auch lange und hart gearbeitet hat.
Dennoch kann uns das beruhigen bezüglich unseres eigenen Eindrucks, ein schlechtes Gedächtnis zu haben. 300 erinnerte Episoden aus 50 Jahren scheint machbar.
Diese erinnerbaren Episoden verteilen sich natürlich nicht gleichmäßig über das Leben. Bei fast allen Menschen gibt es zwei Phasen, an denen die Zahl unserer Erinnerungen abweicht von der rechnerischen Vergessenskurve: Es gibt eine Erinnerungshäufung aus dem Alter von 15-25 Jahren, Pubertät und junges Erwachsensein; und die sogenannte Kindheitsamnesie für Erinnerungen vor dem Alter ca. 4 Jahren. Aus dieser Zeit erinnern wir als Erwachsene fast nichts mehr, obwohl Kinder bis zum Alter von ca. vier Jahren durchaus ein gutes Gedächtnis für die zurückliegenden 2-3 Jahre haben. Es gibt keine eindeutige Erklärung dafür.
Die Organisation autobiographischen Wissens
Eine weitere Frage, mit der sich die Kognitionsforschung beschäftigt, ist die Organisation unseres autobiografischen Wissens. Darüber wissen wir einiges.
Das Grundprinzip ist die Assoziation. Informationen, die zusammengehören, werden miteinander verknüpft. Das heißt für uns ganz praktisch: Je mehr wir bereits erinnern, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns noch weitere Erinnerungen zugänglich werden, weil es mehr Ausgangspunkte für Assoziationen gibt, sogenannte Hinweisreize bzw. Abrufhinweise.
Deshalb klappt das „Zurück zu den Anfängen“ auch meist viel besser als vorher befürchtet.
Zweites Ordnungsprinzip, neben der Assoziation, ist die Chronologie, ein gewisses Zeitraster, das zwar nicht sehr genau ist, aber dennoch den Hintergrund bietet, in den das episodische Gedächtnis eingebettet ist. Damit arbeiten wir bei „Zurück zu den Anfängen“ hauptsächlich.
Weitere Ordnungsmerkmale sind: Typische Lebensthemen, die bei den meisten Menschen vorkommen; und zeitliche Referenzpunkte durch wichtige Lebensereignisse.
Unsere Ziele organisieren unser autobiographisches Gedächtnis
Ein zunehmend als wichtig erkanntes Prinzip des autobiographischen Gedächtnisses ist, dass es sich an Zielen orientiert. Unsere Ziele kontrollieren und beeinflussen, was und wie wir erinnern.
Ein ganz plattes Beispiel: Ein Haus wird durch zwei Personen besichtigt: durch einen Dieb, und einen Kaufinteressenten. Beider Erinnerung danach ist wahrheitsgetreu, obwohl sie völlig andere Dinge erinnern: die beweglichen Wertgegenstände beim einen, und vielleicht der Zustand des Dachs beim anderen.
So passiert das unser ganzes Leben hindurch: Unsere Ziele orientieren unsere Erinnerung. Dabei dienen vor allem Emotionen dazu, die Ereignisse als zielgerichtete Geschichten zu organisieren. Emotionen und Ziele sind zentrale Organisatoren unseres autobiographischen Gedächtnisses.
Persönliche Ereignis-Erinnerungen
Wenn wir uns durch unser Leben erinnern, wie wir das bei „Zurück zu den Anfängen“ tun, stehen oft persönliche Ereignis-Erinnerungen im Vordergrund. Ein Beispiel: Die ersten Begegnungen mit einer zukünftigen Partnerin.
Solche Erinnerungen sind spezifisch, detailliert, sind begleitet von einem Gefühl von Wiedererleben, sind zeitlich und örtlich zuzuordnen. Sie vermitteln uns das Gefühl, das selbst erlebt zu haben, und dass sie eine wahre Wiedergabe dessen sind, was tatsächlich geschah.
Zu solchen persönlichen Ereignis-Erinnerungen gehören auch Dinge, die uns jemand sagte und die wichtig für unser Leben wurden; Ereignisse, die wir als Lektionen oder Fingerzeig für unser weiteres Lebens erleben; Erst-Ereignisse, also wo etwas begonnen hat; eine Neigung, ein Beruf, eine Beziehung.
Ein Spezialfall davon sind selbst-definierende Erinnerungen. Also Ereignisse, die für uns definieren, wer wir sind. Typische und häufig vorkommende Oberthemen sind bei diesen einerseits Leistung und Macht (oder ihr Fehlen); andererseits Beziehung und soziale Motive.
In diesem Vortrag würde es zu weit führen, auf all die Möglichkeiten einzugehen, wie unser autobiographisches Gedächtnis ein Problem sein kann. Zum Beispiel wenn es falsch oder verfälschend ist. Oder wenn Erinnerungen komplett fehlen, wie bei Amnesien.
Oder traumatische Erinnerungen, und die speziellen Phänomene, die es um sie herum gibt.
Mehr über das autobiographische Gedächtnis z.B. in dem detaillierten, aber gut lesbaren Buch von Rüdiger Pohl (2007) Das autobiographische Gedächtnis: Die Psychologie unserer Lebensgeschichte.
Selbst als Narrativ
Zum Schluss möchte ich noch auf die These eingehen, dass es einen Zusammenhang zwischen unseren autobiographischen Erinnerungen und unserem aktuellen Selbstkonzept gibt. Dass unser Selbst, wer wir sind, sich zusammensetzt aus Narrativen, die sich wiederum aus unserer Biographie und Erinnerung speisen.
Der Gedanke ist unmittelbar einsichtig und intuitiv nachvollziehbar. Üblicherweise denken wir dann an große, übergreifende Erzählungen, die unser Leben als Ganzes sinnvoll machen, wir entwickeln Heldenreisen, Bekehrungs- und Erlösungsgeschichten. Die großen Bögen, die unser menschliches Selbst als narrative Einheit darstellen.
In der Philosophie ist diese Auffassung in den letzten Jahrzehnten groß in Mode. Viele wichtige Namen sind damit verknüpft, Alasdair MyIntyre, Charles Taylor, Jerome Bruner, Paul Ricoeur, Maria Schechtman, Oliver Sacks, Daniel Dennett… (Ausführliche Zusammenfassung bei Adler 2010).
In der Lebenspraxis haben diese großen Narrative aber oft wenig Bedeutung. Ja, wenn wir über uns erzählen sollen, dann holen wir sie hervor. Aber das praktische Leben ist sowohl banaler als auch kleinteiliger.
Der innere Monolog als Narrativ

Im Alltag sind es doch zunächst unsere Gedanken von Augenblick zu Augenblick, unser ständiger innerer Monolog, der unser Fühlen und Handeln bestimmt. Die Kognitive Therapie, zurückgehend auf Aaron Beck und Albert Ellis, beschreibt unsere ständigen automatischen und meist negativen Gedanken. Gedanken wie: „Ich bin nicht gut genug“, „Das wird nie mehr anders“ – wir kennen das. Ein typischer Mechanismus, und häufiger (Mit-)Auslöser für Depression.
Klassisch ist die Liste der „11 irrationalen Gedanken“ von Albert Ellis. Dazu gehören z.B.:
- “Ich muss von allen wichtigen Menschen in meinem Umfeld geliebt werden und brauche ihre Bestätigung.”
- “Um etwas wert zu sein, muss ich alles erreichen, was ich mir vornehme.”
- “Es ist schrecklich und katastrophal, dass die Dinge nicht so laufen, wie ich das gern hätte.”
- “Menschliches Unglück hat externe Ursachen und ich kann nichts, oder fast nichts, tun, um es zu verhindern oder den Schmerz und das Leiden zu kontrollieren.“
Im letzten Satz erkennen wir den Mechanismus der erlernten Hilflosigkeit (Martin Seligman), der oft auch Depressionen zugrundeliegt.
Das sind eigentlich nur kurze Sätze, nicht das, was wir uns unter einem Narrativ, einer Geschichte vorstellen – aber von riesiger Bedeutung für unser Leben.
Die australische Autorin Madonna King hat für ihr gerade erschienenes Buch (2021) mit 500 zehnjährigen Mädchen gesprochen und ist entsetzt, wie sicher sich ganz viele schon sind, was sie alles nicht können: „Mathe ist nicht mein Ding“; „Ich hab’s nicht so mit Englisch“ … Sie limitieren ihr Potential schon mit 10, indem sie Aktivitäten ausblenden, bei denen sie angeblich nicht gut sind – in einem Alter, in dem sie definitiv noch nicht wissen können, was ihnen eigentlich möglich wäre.
Hier sehen wir gut am praktischen Beispiel, wie sich die eigene Identität aus solchen kurzen Überzeugungen, aus wenigen Erfahrungen und den Erinnerungen daran konstruiert. Sie reichen aus, um das Selbstkonzept dieser Mädchen dauerhaft zu beeinflussen. Vielleicht ihren ganzen Lebenslauf.
Unser Leben als Narrativ
Das ist also die Idee, dass unsere ganze Identität, unsere Person, letztlich aus solchen Narrativen zusammengesetzt ist, die wiederum überwiegend autobiographisch sind. Die eigene Vorgeschichte bestimmt die Qualität der gegenwärtigen Erfahrungen.
Diese philosophischen Theorien über unser Leben als Narrativ sind spannend, aber wenn man sich mehr damit beschäftigt, stellt man fest, dass sie für das praktische Leben nicht wirklich hilfreich sind.
In seiner 250-seitigen Dissertation an der Universität Freiburg (Schweiz), „Das Selbst als Erzählung“, findet Benjamin Adler (2010), dass diese Diskussion eher Probleme schafft statt als praktischer Lösungsansatz zu dienen. Einige Zitate aus diesem Werk, von mir verkürzt und zusammengezogen:
„Ich meine, dass die Antwort lautet, dass es nicht eine grosse, sondern viele und verschiedene Erzählungen sind. (…) Die kurzen Erzählungen, die unseren Alltag prägen, [sind] von Bedeutung für unser Selbstverständnis. (…)
(…) die philosophisch geprägten Ansätze narrativer Selbstkonzeptionen (…) geben uns wie so oft in der Philosophie keine konkrete Antwort auf die Frage, wer wir sind (…) In Bezug auf die Identität des Selbst [sollten] wir nicht bei abstrakten Prinzipien (…) verharren (…), sondern dem genauen Hinschauen gegenüber der Verallgemeinerung den Vorzug geben (…)“. (Adler 2010)
Diesen Hinweis haben wir schon vorher gehört. Er wird damit zu einer zentralen Botschaft meines Vortrags, ohne dass ich das vorhergesehen oder geplant habe. Diese Botschaft könnte ich so zusammenfassen:
Schaut auf das Detail, seid konkret, schaut die kleinen Einheiten an. Große Ideen können verwirren, konkrete Details erhellen.
Brauchen wir das große Narrativ?
Es gibt die Auffassung, dass in unserer postmodernen Zeit, in der die Menschen keine festen Rollen und dauerhafte Plätze in der Gesellschaft haben, es wichtig ist, dass wir durch solche übergreifenden Narrative eine Identität schaffen können. Weil wir sonst auseinanderfallen unter der Vielfältigkeit der multiplen Perspektiven unserer postmodernen Zeit. (Ausführlich im lesenswerten Text von Wolfgang Kraus: Identität als Narration).
Daran ist sicher etwas.
 Aus buddhistischer Sicht könnte man allerdings sagen, dass gerade das eben der Realität entspricht: Es gibt kein „Zentrum das hält“ (William Butler Yeats). Die eine Geschichte, die alles kohärent und stimmig zusammenfügt, ist eine Illusion.
Aus buddhistischer Sicht könnte man allerdings sagen, dass gerade das eben der Realität entspricht: Es gibt kein „Zentrum das hält“ (William Butler Yeats). Die eine Geschichte, die alles kohärent und stimmig zusammenfügt, ist eine Illusion.
Vielleicht brauchen wir sie auch nur dann, wenn wir verunsichert sind, über uns selbst, über die Realität, über unsere Ziele. Wenn wir uns besser kennen, wenn wir uns gründlich erforscht haben, wenn wir in „Zurück zu den Anfängen“ gesehen haben, dass da keine Ungeheuer im Schrank sind – dann brauchen wir vielleicht am Ende keine eine, einfache Geschichte mehr.
Wenn wir Möglichkeiten entwickeln, uns in die flirrende Vielfalt des Lebens hinein zu entspannen, haben wir letztlich mehr davon, als Halt in großen Geschichten zu suchen.
Schluß
Es mag beängstigend sein, uns vorzustellen dass wir, unsere Persönlichkeit, nur aus Narrativen und Skripten bestehen und sonst gar nichts. Es weiß ja auch niemand, ob das wirklich so ist; es ist eine Idee.
Aber der Gedanke hat auch etwas sehr Befreiendes!
Er erinnert an das Konzept der Leerheit im Buddhismus, Leerheit der Welt, Leerheit des Selbst.
Die gute Nachricht ist doch: Eine Skript, ein Narrativ, eine Geschichte ist veränderbar. Wir haben gesehen, dass unsere scheinbar unabänderliche, da bereits geschehene Vergangenheit in unserer Erinnerung durchaus veränderlich ist, durch unsere Ziele, durch unseren Blick von heute. Und morgen durch den Blick von morgen. Und Übermorgen durch den Blick von übermorgen.
Vielleicht ist auch unsere Persönlichkeit veränderbar? Ein bißchen Humor dazutun, ein bißchen Gemeinheit rausnehmen?
Die Psychologin Wiebke Bleidorn forscht an der University of California, Davis, über die Bedingungen unter denen Persönlichkeit sich verändern kann. Sie sagt: „Spezifische Ziele und Intentionen sind da wichtig. Wir müssen uns fragen: Wie bin ich jetzt? Was will ich ändern, was wäre ideal? Was muss ich tun, dass der Abstand zwischen den beiden kleiner wird?“
Das ist genau das, was wir mit „Zurück zu den Anfängen“ unternehmen.
Wir schauen, wie wir sind. Und dann: Was muss ich tun, dass der Abstand zu meinen Idealen kleiner wird.
Seine Ideale erreichen – was soll’s, wer tut das schon. Aber zu schauen, dass der Abstand zu ihnen immer wieder ein bißchen kleiner wird, das ist eine sehr menschliche und ermutigende Sichtweise.
Literatur
Autobiographie (Überblick)
Helga Schwalm (2014) Autobiography. In: Hühn, Peter et al. (eds.): The living handbook of narratology. Hamburg: Hamburg University. https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/129.html
Autobiographisches Schreiben als Therapie
Marilyn R. Chandler (1990) A Healing Art: Therapeutic Dimensions of Autobiography, a/b: Auto/Biography Studies, 5:1, 4-14, https://doi.org/10.1080/08989575.1990.10846709
Boritz, T. Z., Bryntwick, E., & Angus, L. E. (2008, June). Working with autobiographical memory narratives in psychotherapy. [Web article]. https://societyforpsychotherapy.org/working-with-autobiographical-memory-narratives-in-psychotherapy
Expressives Schreiben
James W. Pennebaker (1997) Opening Up: The Healing Power of Expressing Emotions. Guilford Publications (inzwischen: 3rd Edition 2016, „Opening Up by Writing It Down“)
James W. Pennebaker (2010) Heilung durch Schreiben. Ein Arbeitsbuch zur Selbsthilfe. Verlag Hans Huber, Bern
Horn, Andrea B; Mehl, M R (2004) Expressives Schreiben als Copingtechnik: Ein Überblick über den Stand der Forschung. Verhaltenstherapie, 14(4):274-283. DOI: https://doi.org/10.1159/000082837
Autobiographisches Gedächtnis
Pohl, Rüdiger (2007) Das autobiographische Gedächtnis: Die Psychologie unserer Lebensgeschichte. Kohlhammer Verlag
Wikipedia https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Autobiographical_memory
Dan P. McAdams (2001) The Psychology of Life Stories. Review of General Psychology, vol4, no.2, 100-122. https://doi.org/10.1037%2F1089-2680.5.2.100
Selbstbild als Narrativ
Wolfgang Kraus (1999) Identität als Narration: Die narrative Konstruktion von Identitätsprojekten. http://web.fu-berlin.de/postmoderne-psych/berichte3/kraus.htm
Benjamin Adler (2010) Das Selbst als Erzählung. Dissertation, Universität Freiburg (Schweiz). https://core.ac.uk/download/pdf/20655769.pdf
Dan P. McAdams (2001) The Psychology of Life Stories. Review of General Psychology, vol4, no.2, 100-122. https://doi.org/10.1037%2F1089-2680.5.2.100
Madonna King (2021) Ten-ager – What your daughter needs you to know about the transition from child to teen. Hachette.
https://www.theguardian.com/society/2021/jan/31/limiting-potential-from-age-10-how-girls-pigeonhole-themselves
Schreiben und Kreativität
Julia Cameron (2017) Es ist nie zu spät, neu anzufangen: Der Weg des Künstlers ab 60. Knaur MensSana eBook
Gillie Bolton, Penelope Shuttle (2011) Write Yourself: Creative Writing and Personal Development (Writing for Therapy or Personal Development). Jessica Kingsley Publishers
Alle Internet-Links waren zugänglich am 2. Feb 2021.
[Beitragsbild: Caminante – bevorzugtes Selbstbild des Autors. Foto: Claudia Kluge]

